

|
|
|
|
PD Dr. Norbert Böwering
Dipl. Phys. Christian Meier
Dr. Matthias Volkmer
(jetzt: Deutsches Patentamt, München)
Dipl. Phys. Jürgen Lieschke
(jetzt: GeNUA, Kirchheim)
Dipl. Phys. Rüdiger Dreier
(jetzt: Bruker Daltonik GmbH, Bremen)
Prof. Manfred Fink
(The University of Texas at Austin)
Prof. Richard Mawhorter
(Pomona College, Claremont)
Wir untersuchen mittels elastischer Elektronenstreuung Moleküle, die in der Gasphase räumlich ausgerichtet sind. Dabei kommen unterschiedliche Methoden sowohl zur Erzeugung dieser Ausrichtung als auch zur Detektion der Elektronen zur Anwendung:
Moleküle mit einem elektrischen Dipolmoment (symmetrische
Kreiselmolekuele wie Methylhalide in unserem Fall) erfahren durch den
linearen Stark-Effekt in einem elektrostatischem
Hexapol-Feld abhänging vom Vorzeichen der
Rotationsquantenzahlen ihres Zustands
|JKM> eine fokussierend oder
defokussierend wirkende Kraft. Zusätzlich hängt die Stärke der
fokussierenden Kraft von der Quantenzahlen J, K und M ab. Durch eine geeignete
Wahl von Blenden und Hexapolspannung kann so eine bevorzugte Selektion
einzelner Rotationszustände erreicht werden.
In der Kombination einer Überschall-Molekularstrahlquelle mit
Hexapol und einer Elektronenstreueinrichtung
wird die Winkelverteilung der gestreuten Elektronen gemessen. Dabei wurde
gezeigt, dass die Winkelverteilungen der gestreuten Elektronen an
Molekülen, die vorzugsweise parallel oder antiparallel zum
Elektronenstrahl orientiert sind, signifikant von derjenigen unorientierter
Moleküle abweichen:
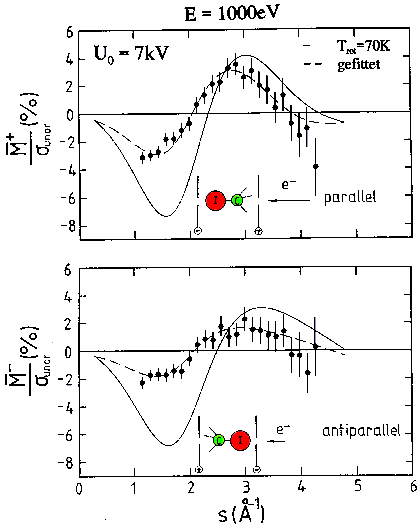
Aufgetragen ist hier gegen den Impulsübertrag s die relative Abweichung
der Streuintensität bezogen auf die Streuung an unorientierten
Molekülen.
In einem weiteren Schritt wurden die Moleküle vorzugsweise senkrecht zum Elektronenstrahl orientiert. Dann ist die Winkelverteilung der Elektronen auch nicht mehr rotationssymmetrisch, wie im folgenden Bild gezeigt:
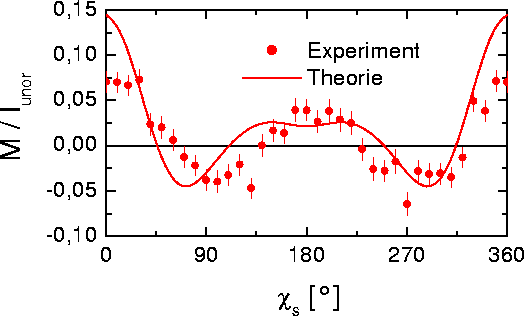
Wieder ist die relative Abweichung der Streuintensität vom unorientierten
Fall aufgetragen, diesmal gegen den azimutalen Streuwinkel.
Bei dieser Methode werden die Moleküle durch Stöße untereinander während der Expansion durch Kapillardüsen ins Vakuum ausgerichtet. Wir nutzen den Filtereffekt bei Molekülstößen aufgrund der Unterschiede im geometrischen Stoßquerschnitt für Moleküle, die wie Propeller oder Frisbees bezüglich ihrer Flugrichtung rotieren. Es können zwar nur geringe Ausrichtungsgrade mit dieser Methode erreicht werden, sie hat jedoch den Vorteil hoher Molekülstrahlintensitäten. Die Elektronenstreu-Untersuchungen dienen hier zur Bestimmung des Ausrichtungsgrades der Moleküle bei unterschiedlichen Expansionsbedingungen. In Übereinstimmung mit Modellrechnungen des Filtereffekts zeigen die Ergebnisse einen Anstieg der gemessenen Ausrichtungsparameter mit dem Düsenvordruck im Fall von n-Butan; für Stickstoffmoleküle hingegen wurde keine signifikante Ausrichtung detektiert:
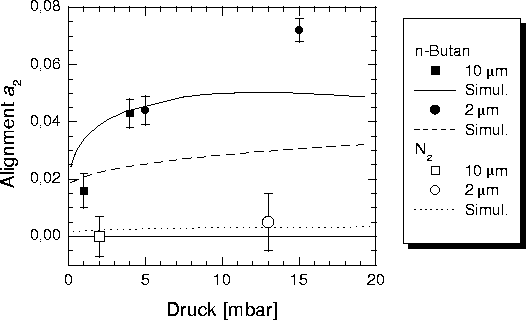
Zur Verbesserung der sehr zeitaufwändigen punktweisen Erfassung der Streuverteilung mit einem beweglichen Detektor wurde ein System entwickelt, das es ermöglicht, die gesamte Streuverteilung simultan aufzunehmen. Dazu werden die gestreuten Elektronen ortsaufgelöst mit einer Multi-Channel-Plate detektiert, verstärkt und auf einen Leuchtschirm beschleunigt. Dessen Bild wird von einer CCD-Kamera aufgenommen und im Computer weiterverarbeitet. Das Aufbauschema des Detektors ist in der nächsten Abbildung dargestellt.
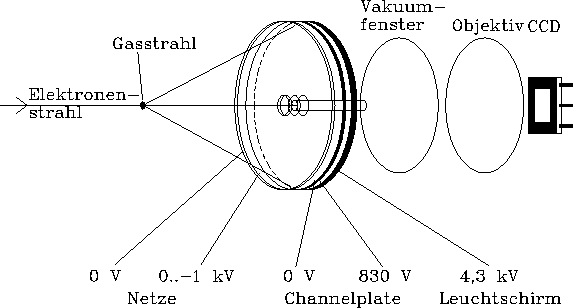
|
|
Kontakt: Christian Meier chmeier@physik.uni-bielefeld.de Last modified: Fri Sep 10 10:22:12 CEST 2004 |

|
Wir haben auf unseren Seiten Hyperlinks zu anderen Seiten im Internet gelegt,
deren Webmaster wir nicht sind. Für alle diese Hyperlinks gilt: Wir
erklären hiermit ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und Inhalte dieser Seiten haben. Deshalb
"distanzieren"
wir uns hiermit von allen Inhalten dieser Seiten und machen uns ihre Inhalte
in keiner Weise zu Eigen.
©2001
Molekül- und Oberflächenphysik
|

|
|
|
|